„Die Annahme, dass die Menschenwürde überall gelte, wo menschliches Leben existiert, ist ein biologistisch-naturalistischer Fehlschluss. Menschenwürde- und Lebensschutz sind rechtlich entkoppelt.“1 Das war vermutlich eines der Aufreger-Zitate in der Debatte um die verschobene Richterwahl von Frauke Brosius-Gersdorf. Aber war die Aufregung wirklich berechtigt? Bei der Aussage jedenfalls stellt sich mir die Frage, was sie wohl mit naturalistischem Fehlschluss meint. Wenn ich das richtig verstehe, wird ja gerade aus ihm gefolgert, dass Menschenwürde- und Lebensschutz rechtlich entkoppelt seien.
Das Thema ist mal wieder so ein Kaninchenbau-Dingens. Man steckt nur mal kurz den Kopf rein und schon tun sich verwundene Gänge auf, die man kaum für möglich gehalten hätte. Naja. Mich hat das trotz allem sehr interessiert, aber ich hab ein bisschen länger gebraucht, weil nicht so richtig klar war, auch wenn sie es sagt, welchen Fehlschluss Brosius-Gersdorf eigentlich meint. Ich versuch euch einfach mal mit rein zu nehmen. Herzlich Willkommen zu Frage eins:
1. Was ist der naturalistische Fehlschluss?
Der Begriff wurde vom englischen Philosophen George Edward Moore geprägt. Moore gehörte in Cambridge neben Bertrand Russel und Ludwig Wittgenstein zu den Häuptlingen der analytischen Philosophie. Und um eine Analyse handelt es sich auch beim naturalistischen Fehlschluss. Ein Begriff den Moore prägte. In seinem Hauptwerk „Principia Ethica“ kam Moore zu dem Schluss, dass es die Hauptaufgabe der Ethik sei, zu klären was der Begriff „gut“ bedeute. Moore schrieb selbst dazu: „Was ‚gut‘ bedeutet, ist, abgesehen von seinem Gegenteil ’schlecht‘ wirklich der einzige einfache Gegenstand des Denkens, der der Ethik eigentümlich ist. Seine Definition ist deshalb der entscheidende Punkt bei der Definition der Ethik; und ein diesbezüglicher Fehler zieht eine weit größere Zahl von fehlerhaften ethischen Urteilen nach sich als jeder andere. Wenn diese erste Frage nicht völlig begriffen und ihre wahre Antwort nicht klar erkannt wird, ist die übrige Ethik als systematische Lehre so gut wie zwecklos.“2
So weit, so gut. Die Messlatte mal eben bis zum Mond geschraubt. Was Moore hier für ein Fass aufmacht, bemerkt man beim ersten schlucken nicht wirklich. Aber dann liegts einem schon schwerer im Magen. Moore brach mit diesen Aussagen zu seiner Zeit mit großen Teilen der philosophischen Tradition und diese seine Denkrichtung war „gleichzeitig eine Neuausrichtung, die den Fortgang der Ethik im 20. Jahrhundert entscheidend prägt[e].“3
1.1 Was ist also „gut“?
Wenn „gut“ zu klären die Hauptaufgabe der Ethik ist, tja, was ist denn dann „gut“ Herr Moore?: „Wenn ich gefragt werde ‚Was ist gut?‘, so lautet meine Antwort, daß gut gut ist und damit ist die Sache erledigt. Oder wenn man mich fragt, ‚Wie ist gut zu definieren?‘, so ist meine Antwort, daß es nicht definiert werden kann, und mehr ist darüber nicht zu sagen.“4
Oookay. In aller Zynik, die ich aufbringen kann: Danke! Erst „gut“ zum wichtigsten Begriff der Ethik erheben, um dann, wenn es einer wissen will, pampig „gut ist gut“ und „gut lässt sich nicht definieren“ zu antworten.

Aber Moment. Vielleicht ist es wichtig zu wissen, dass Moore die Begriffe ‚definieren‘ und ‚analysieren‘ an manchen Stellen in seinem Werk fast schon Synonym verwendet.5 Ihm geht es eigentlich darum die sog. Atome unserer Sprache herauszufinden. Die Teile, die auch durch Analyse nicht mehr teilbar sind. Er sucht nach den einfachen Bedeutungselementen und die „These von der Undefinierbarkeit von ‚gut‘ meint […], dass ‚gut‘ wie viele andere Begriffe nicht aus anderen, primitiveren Bedeutungselementen zusammengesetzt ist. Dass es eine Vielzahl solcher einfachen, undefinierbaren, nicht analysierbaren, primtiven Begriffe geben muss, hält Moore für offensichtlich. Nur mit ihrer Hilfe lassen sich überhaupt Bedeutungsanalysen durchführen. Denn wenn es keine primitiven Bedeutungselemente gäbe, würden Bedeutungsanalysen grundsätzlich an kein Ende kommen.“6 Soll heißen, irgendwann muss Schluss sein. Man kann nicht ewig über den Inhalt von Begriffen philosophieren. Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann muss es Begriffe geben, die einfach feststehen. Denn sonst würde Moore beim diskutieren irgendwann rot sehen. Apropos rot. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen rot und dem FC Bayern?
1.2 FC Bayern München ist Rot aber nicht umgekehrt
Kurze Vorbemerkung: Der Denker von der Insel bringt zur Erläuterung von primitiven Bedeutungselementen und zusammengesetzten Begriffen den Vergleich zwischen Pferd und Gelb. Ich schreibe euch den in die Fussnoten.7 Hier würde ich jetzt aber gern das Prinzip anhand des FC Bayern und Rot erklären. So habe ich es nach wochenlangen grübeln und hören langweiliger Vorträge endlich in der Tiefe verstanden.8
Also: Der Begriff des FC Bayern München ist defintiv kein einfacher, sondern ein sehr komplexer. Jemanden der nichts mit Fußball am Schuh hat, könnte man diesen Verein zur Erklärung sehr ausführlich beschreiben. Neben den zwei schon genannten Eigenschaften (Fußball und Verein) gäbe es da z.B. noch die Historie als Rekordmeister oder dass sie 2011 und 2012 die Meisterschaft der deutschen Bundesliga an Borussia Dortmund verloren haben. Des Weiteren gehören u.a. zum FCB die Namen Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, Thomas Müller oder Gerd Müller. Die Allianz Arena als Spielstätte, wäre auch zu nennen. Und sooo weiter. Es gäbe viele Dinge, Begriffe, die wir verwenden könnten um den FC Bayern in seiner Komplexität zu beschreiben, zu definieren.
Bei Rot hingegen verhält sich das anders. Bei jemanden, der nicht weiß was Rot ist, können wir nach Moore’s Ansicht nicht die gleiche Erklärungsstruktur verwenden. Rot ist eben rot. Es handelt sich hier um einen einfachen und keinen komplexen Begriff wie z.B. FC Bayern München einer ist.
Das heißt aber nicht, dass die Eigentschaft rot nicht bestimmten Dingen zugeschrieben werden kann. Der FC Bayern ist ja in seinen Vereinsfarben u.a. rot. Aber und jetzt kommt die Krux: Rot ist nicht der FC Bayern. Rot ist Rot. Und Rot kann auch keine anderen Eigenschaften wie z.B. Gelb annehmen. Versteht ihr was ich, Moore nach-denkend, meine? Ich kann rot im Grunde nicht mit etwas anderem als es selbst definieren. Sonst würde ich, wie wir gleich noch analysieren werden, einen naturalistischen Fehlschluss begehen. Den FC Bayern hingegen könnte ich sehr viel ausführlicher definieren, wenn ich denn ein Fan von diesem Verein wäre.
Um es nochmal zu betonen: Der FC Bayern ist u.a. rot. Aber Rot ist nicht der FC Bayern. Sonst wär’s ein naturalistischer Fehlschluss. Vielleicht liest sich das für den ein oder anderen sinnlos. Und mittlerweile auch nervig. Aber darin liegt der Kern von Moore’s Gedanken. Germanisten, oder wer auch immer, könnten jetzt euch vielleicht noch die jeweiligen Fachbegriffe und weitere Erklärungen liefern. Super gern in den Kommentaren, wer dazu noch Gedanken und Ideen hat!
1.3 Lassen wir’s gut sein
Gut fällt in die gleiche Kategorie wie das eben bebeispielte rot. Natürlich kann man Dingen, wie bei rot, auch die Eigenschaft gut zuschreiben. Das ist es nicht, was Moore mit seiner Undefinierbarkeits-These sagen will. Er ist natürlich der Überzeugung, dass Dinge gut sein können. Aber er widerspricht wehement, dass gut ein Ding (z.B. FC Bayern) oder irgendetwas anders als gut (z.B. rot ist nicht gelb) sei.
Do you want Moore? Um das Gesagte mal zu bündeln: Er schreibt, dass ein „solch simpler Fehler in bezug auf ‚gut‘ weit verbreitet [ist]. Es mag sein, daß alle Dinge, die gut sind, auch etwas anderes sind, so wie alle Dinge, die gelb [oder rot] sind, eine gewisse Art der Lichtschwingung hervorrufen. Und es steht fest, daß die Ethik entdecken will, welches diese anderen Eigenschaften sind, die allen Dingen, die gut sind, zukommen. Aber viel zu viele Philosophen haben gemeint, daß sie, wenn sie diese anderen Eigenschaften nennen, tatsächlich ‚gut‘ definieren; daß diese Eigenschaften in Wirklichkeit nicht ‚andere‘ seien, sondern absolut und vollständig gleichbedeutend mit Gutheit. Diese Ansicht möchte ich den ’naturalistischen Fehlschluss‘ nennen“.9
Alles klar soweit?
1.4 Zwischenfazit zum Brosius-Gersdorf Zitat
Nochmal: Der naturalistische Fehlschluss liegt also darin, den Begriff gut, welcher in Moores Augen der Grundbegriff aller Ethik ist, durch ein Ding oder eine andere Eigenschaft zu definieren, zu ersetzen oder anderweitig zu analysieren. Diesen ’simplen‘ Fehler würde man begehen, wenn man die anderen Eigenschaften, die die Dinge haben, die gut sind, mit gut gleich- bzw. gut durch sie ersetzt.
Wenden wir jetzt diese Einsicht doch mal auf das eingangs erwähnte Zitat an: „Die Annahme, dass die Menschenwürde überall gelte, wo menschliches Leben existiert, ist ein biologistisch-naturalistischer Fehlschluss.“10 Man müsste hier davon ausgehen, dass das menschliche Leben gut ist und dass menschliches Leben existiert. Logo. Und nun vermute ich, dass, wenn es sich hier wirklich um einen naturalistischen Fehlschluss handeln soll, dass das was Brsoius-Gersdorf’s Meinung nach den Begriff gut ersetzt, die ‚Existenz‘ ist. Sie erläutert aber hier leider nicht, was sie wirklich meint. Sie wirft da einen Knochen hin, der ruhig etwas mehr Fleisch gehabt haben könnte.
Wenn wir jetzt also sagen ‚gut ist, dass menschliches Leben existiert‘ dann begehen wir hundertpro einen naturalistischen Fehlschluss. Seid ihr dabei? Um das noch zu vervollständigen, für Moore wäre es okay zu sagen, dass die ‚Existenz menschlichen Leben’s gut ist‘. Aber rückwirkend könnte man in dieser Logik nicht sagen, dass gut, per Definition, die Existenz menschlichen Lebens ist. Wenn Brosius-Gersdorf denn wirklich so tief bohrt. Aber erst machen wir Moore bis zum Ende fertig. Und dann ist irgendwann auch mal gut!
1.5 Gut oder nicht gut, das ist hier die offene Frage11
Um zu erkennen ob es um einen naturalistischen Fehlschluss handelt und um zu zeigen, dass gut definitiv undefnierbar ist, bläst G.E. Moore für die Begründung zur Gegenthese. Damit will er überprüfen, ob es nicht doch sein könnte dass gut eine komplexe Eigenschaft bezeichnet und daher plötzlich doch definierbar wäre. Darum müsste die These der gut Definition einer Gegenthese standhalten.
Also: Wenn wir nun der Meinung sind, dass gut die Existenz menschlichen Lebens ist, könnten wir auch gleich ‚menschliches Leben existiert‚ sagen. Gesetzt dem Fall wir halten gut für die Existenz menschlichen Lebens. Dass dies aber ein naturalistischer Fehlschluss wäre, wenn wir gut auf diese Weise ersetzten, würde sich daran zeigen, und jetzt kommt Moore’s Gegenthese, wenn wir folgende Frage sinnvoll stellen können:
(i) „Ist es gut, dass menschliches Leben existiert?“
Wäre unsere Definition von gut geglückt, dann stünde jetzt hier keine offene Frage, die in der Debatte in der Lage wäre für uns neue Erkenntnisse zu Tage zufördern. Wäre sie geglückt, könnten wir einfach danach fragen (ii) ob es gut ist, dass menschliches Leben gut ist. Da ich und scheinbar neben Moore auch ihr den Eindruck habt, dass die erste Frage (i) im Gegensatz zur zweiten (ii) eine sinnvoll gestellte, deren Antwort offen ist,12 so handelt es sich hier laut Moore wohl um einen naturalistischen Fehlschluss. Gut ist, dass menschliches Leben gut ist, wäre (ii) so was wie X=X. Ein tautologisch, geschlossene System, aus dem wir keinen Erkenntnisgewinn ziehen können.
Und schon sind wir bei der nächsten Krux angelangt. „Solche Versuche haben immer die logische Form ‚gut bedeutet n‘. Aussagen der Art ‚A ist gut‘ lassen sich demnach in Aussagen der Art ‚A ist n‘ überführen.“13 In unserem Falle:
gut bedeutet n = gut bedeutet existent
A ist gut = menschliches Leben ist gut
Dies liese sich überführen in
A ist n = menschliches Leben existiert
„Aussagen dieser Art erlauben aber stets – und das ist der Kern des Arguments der offenen Frage – die Rückfrage ‚Aber ist A auch gut‘? Die Versicherung ‚A ist n‘ klärt oder ’schließt‘ diese Frage niemals.“14 Soll rückgefragt heißen: Ist menschliches Leben wirklich gut? Darauf mit ‚menschliches Leben existiert‘ zu antworten, „klärt oder ’schließt‘ diese Frage niemals.“
1.6 Soll das der naturalistische Fehlschluss Sein? Fazit
Beim naturalistischen Fehlschluss handelt es sich, und darüber ist die Literatur sich eigentlich einig, nicht wirklich um einen Schluss, sondern eher um eine Fehlannahme, Fehldefinition oder Fehlanalyse.
Ich habe versucht, im Sinne George Edward Moores, anhand von Brosius-Gersdorf’s Zitat aufzuzeigen was sie meinen könnte. Demnach würde sie der gültigen Rechtsprechung und den Lebenschützern vorwerfen, dass diese gut mit der Existenz menschlichen Lebens definieren bzw. gut mit existieren ersetzt hätten.
Deswegen haben wir die offen Frage ‚Ist es gut, dass menschliches Leben existiert?‚ herausgearbeitet. Und da diese einen sinnvollen Erkenntisgewinn verspricht, gilt es sie nun zu beantworten. Von allen Seiten. Natürlich schickt uns dieser Fehlschluss damit auf eine moralische Reise. Wenn wir schon davon ausgehen, dass das menschlichen Leben gut ist und es dazu noch existiert, was machen wir dann damit? Wie verhalten wir uns? Warum ist es gut? Und warum ist es schlecht? Wann ist es gut? Immer? Wann ist es schlecht? Aber das werden wir jetzt nicht in diesem Beitrag erörtern. Es ging hier um’s Prinzip.
Außerdem bin ich der Meinung, obwohl Moore schon auf unser ethisches Denken und Handeln abzielt, dass Brosius-Gersdorf eigentlich einen anderen Fehlschluss meinte. Wir erinnern uns? „Die Annahme, dass die Menschenwürde überall gelte, wo menschliches Leben existiert, ist ein biologistisch-naturalistischer Fehlschluss. Menschenwürde- und Lebensschutz sind rechtlich entkoppelt.“15 Moore kann da nicht mehr wirklich weiterhelfen. Aber vielleicht David Hume und sein Gesetz, der sog. Sein-Sollen-Fehlschluss.
2. Humes Gesetz bzw. der Sein-Sollen-Fehlschluss
David Hume lebte von 1711-1776. Als schottischer Philosoph aus der Strömung des Empirismus, gilt er als einer der wichtigsten Vertreter der Aufklärung. Scheinbar kommen die Typen alle von der Insel. Wie dem auch sei, alles weitere zu seiner Person findet ihr sicherlich im Netz. Hume jedenfall schrieb in seinem berühmten A Treatise of Human Nature folgende Passage nieder: „Bei jedem System der Moral, das mir bislang begegnet ist, habe ich stets festgestellt, dass der Autor eine gewisse Zeit in der üblichen Argumentationsweise fortschreitet und begründet, dass es einen Gott gibt, oder Beobachtungen über menschliches Verhalten trifft; dann plötzlich stelle ich überrascht fest, dass anstatt der üblichen Satzverknüpfungen, nämlich ‚ist‘ und ‚ist nicht‘, ich nur auf Sätze stoße, welche mit ‚soll‘ oder ‚soll nicht‘ verbunden sind. Diese Änderung geschieht unmerklich. Sie ist jedoch sehr wichtig. Dieses ‚soll‘ oder ‚soll nicht‘ drückt eine neue Verknüpfung oder Behauptung aus. Darum muss sie notwendigerweise beobachtet und erklärt werden. Zugleich muss notwendigerweise ein Grund angegeben werden für dies, was vollständig unbegreiflich erscheint: Wie nämlich diese neue Verknüpfung eine logische Folgerung sein kann von anderen, davon ganz verschiedenen Verknüpfungen“.16
Hume kritisierte, dass aus einem bloßen „Sein“ plötzlich ein „Sollen“ abgeleitet wird. Hume meinte, so erklärt es Dietmar Hübner in seinem Vortrag über Hume und Moore, dass „aus Tatsachen-Behauptungen keine Werturteile, aus Fakten keine Normen, aus Feststellungen keine Forderungen, aus Indikativen keine Imperative, aus deskriptiven Sätzen keine präskriptiven“17 abgleitet werden können. Somit entstand Humes Gesetz. Oder, anders formuliert, der Sein-Sollen-Fehlschluss.
In der Annahme, „dass die Menschenwürde überall gelte, wo menschliches Leben existiert“, würde es bedeuten, dass die bloße Existenz menschlichen Lebens, also das Da-Sein des Menschen, noch nicht erklären würde warum man’s menschenwürdig schützen sollte, warum ihm die unantastbare Menschenwürde zu kommen sollte. Vermutlich ist es das, was Brosius-Gersdorf irrtümlicherweise mit den naturalistischen Fehlschluss bezeichnet hat und das zur Folge hat, dass Menschenwürde- und Lebenschutz rechtlich entkoppelt seien. (Wobei sie Menschenwürdeschutz eh als eine staatliche Aufgabe ansieht und Lebensschutz eher ein zwischenmenschliches, ein subjektives-moralishces Recht, das gesetzlich zu regeln ist.18)
Neben ihr hat z.B. Reinhard Merkel, der u.a. in seinem Forschungsobjekt Embryo versucht die SKIP-Argumente zu zerlegen, in eine sehr ähnliche Richtung argumentiert. Und auch er klärt nicht ob er jetzt Hume oder Moore meint.19 Sie zaubern scheinbar beides Synonym aus dem Hut. Krümelkackerei? Mag sein. Wie dem auch sei, um nichts aus dem Kontext zu reißen, gönnen wir Merkel ein paar Zeilen Redezeit:
„Wer allein das Faktum einer bestimmten biologischen Beschaffenheit heranzieht, um eine Norm zu begründen – nämlich ein Recht des Embryos auf Leben und damit eine Pflicht aller anderen, seine Tötung zu unterlassen -, der demonstriert Exemplarisch, was Philosophen einen ‚Sein-Sollen-‚ bzw. elnen naturalistischen Fehlschluß nennen. Das bedeutet nicht, daß die auf diesen Fehlchluß gestützte Behauptung falsch ist. Es bedeutet nur, daß der Schluß falsch ist, daß also die Behauptung jedenfalls nicht von ihm begründet wird. Dem Embryo mag sehr wohl ein genuines Recht auf Leben zuzuschreiben sein. Doch folgt dies nicht aus seiner biologischen Zugehörigkeit zur Gattung Mensch. […] Denn (und das stellt der Hinweis auf den Sein-Sollen-Fehlschluß ebenfalls klar) auch bei allen geborenen Menschen folgt die unbezweifelte Norm, daß sie Grundrechte haben, nicht aus dem bloßen Faktum ihrer biologischen Beschaffenheit als Mitglieder einer bestimmten Spezies. Anders gewendet: nicht weil unsere Biologie so ist, wie sie ist, sind wir Inhaber von Rechten, sondern weil Menschen typischerweise bestimmte Eigenschaften haben, die besonders zu schützen ein moralisches Gebot ist und die wir so bei keiner anderen uns bekannten Spezies finden. Gewiß sind diese Eigenschaften die Folge unserer biologischen Beschaffenheit. Aber erst eine dann und dazu herangezogene Norm, daß solche Eigenschaften auf besondere Weise schutzwürdig sind, und nicht einfach das faktische Vorhandensein der Eigenschaften, begründet das normative Fundament, aus dem weitere Normen schlüssig ableitbar sind, vor allem subjektive moralische Rechte auf Schutz. Um das zu veranschaulichen, stelle man sich Jemanden vor, der fragt: ‚Warum eigentlich haben Menschen so etwas wie tundamentale Rechte?‘ Es liegt auf der Hand, daß die Erwiderung ‚Weil sie Menschen sind‘ die Frage nicht beantwortet, sondern deren Inhalt einfach als Behauptung wiederholt. Das weiß der Fragende schon; es ist ja in seiner Frage vorausgesetzt. Warum es so ist, erfährt er aus dieser Antwort nicht. Und er kann es nur aus einer erfahren, die ihm den normativer Grund für den Schutz von Angehörigen dieser biologischen Spezies deutlich macht.“20
Kurze Kommentierung: Dem von uns fett gedruckten Satz, steht schon eine Kommentierung des deutschen Grundgesetz von Matthias Herdegen entgegen. Herdegen dachte schon an Grundrechte mit Spielraum, schrieb aber im gleichnamigen Beitrag: „Träger der Menschenwürde ist zunächst jede geborene Person kraft Zugehörigkeit zur Spezies ‚Mensch‘. Die allen Menschen als Gattungswesen zukommende Würde hängt nicht an irgendwelchen geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Einzelnen oder sozialen Merkmalen.“21 Und präziser bedeutet Menschenwürde, so formuliert es der ehemalige Bundesverfassungsrichter und Rechtsphilosoph Ernst-Wolfgang Böckenförde, im Kern „Zweck an sich selbst“ (Kant) „oder der vom Bundesverfassungsgericht gegebenen Definition ‚Dasein um seiner selbst willen‘. […] Darin sind die Stellung und Anerkennung als eigenes Subjekt, die Freiheit zur eigenen Entfaltung, der Ausschluss von Erniedrigung und Instrumentalisierung nach Art einer Sache, über die einfach verfügt werden kann, positiv gewendet, das Recht auf Rechte, die es zu achten und zu schützen galt, eingeschlossen.“22
Wir hätten da ja schon eine Antwort ob und warum der Mensch schützenswert ist. Alles im Bewußtsein einer Verantwortung vor Gott und den Menschen23 natürlich. Da wäre zum Einen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und Jeder das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit hat.24 Aber, ja, ja, wir verstehen eventuell schon, dass „ist“ und „hat“ ja nur so Seins-Zustände sind. Wenn ich Hume hier nach-denke, dann sagt das noch nichts darüber aus, was ich machen soll. Und sowieso scheint ja alles zusammenhangslos entkoppelt zu sein. Die Naturrechtler raufen sich schon die Haare und haben alle Fingernägel abgekaut.25 Das ist jedoch ein anderes Thema. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wen’s aber interessiert, in Macron’s Kunst-Personen-griff bzw. Was ist der Mensch? stünde noch mehr.
Aber wir schweifen ab und lassen uns jetzt schon in die Diskussion ein. Vielleicht diskutieren wir ja dann in den Kommentare darüber.
2.1. Sein-Sollen-Fazit
Jetzt kennen wir auch Humes Gesetz, den Sein-Sollen-Fehlschluss. Ich bin überzeugt, dass Brosius-Gersdorf eigentlich den meint. Sie geht in ihrem Kommissions-Beitrag, so wie oben Merkel, relativ häufig auf die SKIP Argumente ein.26 In ihrem Beitrag Menschenwürdegarantie und Lebensrecht für das Ungeborene – Reformbedarf beim Schwangerschaftsabbruch heißt es zudem: „Für die Geltung des Art. 1 I GG erst ab Geburt, spricht, dass zwischen dem Ungeborenen und dem geborenen Menschen trotz ihrer beider Zugehörigkeit zur Spezies Mensch, der kontinuierlichen Entwicklung des Embryos/Fetus, seiner Identität mit dem später geborenen Menschen und seinem Potenzial, sich zum geborenen Menschen zu entwickeln (sog. SKIP-Argumente) im Hinblick auf die Würdebegabung Unterschiede bestehen. Die SKIP-Argumente verfangen nicht zur Begründung von vorgeburtlichem Würdeschutz. Würdeschutz für den Embryo/Fetus folgt auch nicht aus der vorgeburtlichen Geltung des Art. 2 II 1 GG, weil der personale Schutz von Art. 1 I und Art. 2 II 1 GG nicht kongruent sind. Die Annahme, dass die Menschenwürde überall gelte, wo menschliches Leben existiert, ist ein biologistisch-naturalistischer Fehlschluss. Menschenwürde- und Lebensschutz sind rechtlich entkoppelt.“27
Schade eigentlich, denn wer die Würde nicht von Anfang an respektiert, wie es der ehemalige Bundesverfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde noch anmahnte28, der nimmt nicht dem anderen seine Würde, sondern er verliert die eigene.29 Denn, so schreibt es Robert Spaemann, die „Würde des Menschen ist in dem Sinne unantastbar, daß sie von außen nicht geraubt werden kann. Man kann nur selbst die eigene Würde verlieren. Von anderen kann sie nur insoweit verletzt werden, als sie nicht respektiert wird.“30
3. Abschließende Gedanken
Ludwig Wittgenstein, der bei Moore in die Lehre ging, machte ebenfalls einen Unterschied zwischen den Tatsachen, dem Sein, bei ihm heißt es Wahrheitswerte der Logik, und dem Sollen, den Wahrheitswerten der Ethik. Er schreibt im Tractatus: „Wir fühlen, daß selbst, wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind.“31 Diese Grenzziehung zwischen der Welt der Seins-Tatsachen und dem ethischen Sollen, auf die Wittgenstein hier anspielt und die wir bei Hume und Brosius-Gersdorf gesehen haben, war und ist folgenreich. „Denn daraus [aus dieser Grenzziehung] resultiert, dass ich zwar die Gesamtheit aller Tatsachen kennen kann und doch dadurch über das Leben selbst noch gar nichts weiß.“ So beschreibt es Volker Braumann in seiner sehr hörenswerten Kommentierung zu Wittgensteins Tractatus auf audible.
Und Braumann weiter: „Stellen wir uns einen Moment vor, die Gesamtheit der Tatsachen der Welt, würde sich in der Gesamtheit aller bekannten Formeln des Tafelwerks erschöpfen. Stellen wir uns nun weiter vor, wir würden diese Formeln in und auswendig kennen. Was aber würden uns diese Formeln über das gute Leben mitteilen können? Aus den Formeln der Relativitätstheorie oder der Quantenphysik folgt in ethischer Hinsicht überhaupt nichts. Denn beide mögen zwar mit ihren Formeln mehr oder weniger wahrscheinliche Tatsachenbeschreibungen [Seins-Beschreibungen] sein, aber ethische Sätze, die für uns als moralisches Wesen handlungsleitend sein könnten, lassen sich aus ihnen nicht ableiten. Einsteins moralische Skrupel gegenüber den Bau der Atombombe führten dazu, dass er sich nicht am Manhatten Projekt beteiligte. Andere Physiker dagegen, wie Oppenheimer oder Fermi, hielten ähnliche Skrupel, die sie vielleicht gehabt haben mögen, nicht davon ab die Bombe zu bauen. Am Beispiel der Physik, und ganz direkt am Beispiel der Atombombe, merken wir, dass die Welt der Tatsachen, so wie wir sie in unseren Beschreibungen vorfinden, eine Aufgabe ist, eine Herausforderung an jeden Einzelnen von uns, die es ethisch zu bewältigen gilt. Dies meint dann wohl auch der bekannte Satz, dass nicht alles was technisch machbar ist, auch ethisch richtig ist.“32
Formulieren wir Braumann noch ein wenig um, dann wird deutlich, was ich mit diesem kleinen Umweg über Wittgenstein wollte. Und wer es verstanden hat, der liest Moore.33 Die Existenz menschlichen Lebens, „so wie wir sie in unseren Beschreibungen vorfinden, eine Aufgabe ist, eine Herausforderung an jeden Einzelnen von uns, die es ethisch zu bewältigen gilt. Dies meint dann wohl auch der bekannte Satz, dass nicht alles was technisch machbar oder rechtlich entkoppelbar ist, auch ethisch richtig ist.“34
Titelbild: https://unsplash.com/de/fotos/orange-und-blaues-rundes-licht–SmCKTIcH5E?utm_content=creditShareLink&utm_medium=referral&utm_source=unsplash; FC_Bayern: https://unsplash.com/de/fotos/rot-weisses-stadion-tagsuber-unter-blauem-himmel-wxggXydWNdE?utm_content=creditShareLink&utm_medium=referral&utm_source=unsplash; Do_More: https://unsplash.com/de/fotos/ein-mann-schaut-auf-einen-computerbildschirm-V7Zc9Uu5l3E?utm_content=creditShareLink&utm_medium=referral&utm_source=unsplash; Baby: https://unsplash.com/de/fotos/wasserschopfkelle-fur-kinder-heben-XKpPsuuGE_Q; Mann_küsst_Frau: https://unsplash.com/de/fotos/mann-kusst-frau-auf-der-stirn-weiss-mit-ultraschallfoto-IE8KfewAp-w?utm_content=creditShareLink&utm_medium=referral&utm_source=unsplash; alle zuletzt aufgerufen am 06.08.2025.
- Frauke Brosius-Gersdorf; Menschenwürdegarantie und Lebensrecht für das Ungeborene – Reformbedarf beim Schwangerschaftsabbruch; in Rechtskonflikte: Festschrift für Horst Dreier zum 70. Geburtstag; Hrsg.: Brosius-Gersdorf, Engländer, Funke, Kuch, Tschentscher und Wittreck; 2024; S. 756. ↩︎
- G.E. Moore, Principia Ethica, Reclam, Erweiterte Ausgabe, 1996, S. 34 ↩︎
- Bert Heinrichs; George Edward Moore zur Einführung; Junius Verlag GmbH; 2019; S. 99. ↩︎
- G.E. Moore, Principia Ethica, Reclam, Erweiterte Ausgabe, 1996, S. 36 ↩︎
- Siehe Bert Heinrichs; George Edward Moore zur Einführung; Junius Verlag GmbH; 2019; S. 101. „Tatsächlich ist es gerade die Undefinierbarkeit, die Moore im Folgenden als entscheidendes Merkmal zur Zurückweisung unterschiedlichster ethischer Theorien nutzt.“ (ebd.) ↩︎
- ebd. ↩︎
- G.E. Moore, Principia Ethica, Reclam, Erweiterte Ausgabe, 1996, S. 36-38: „Ich will sagen, daß ‚gut‘ ein einfacher Begriff ist, so wie ‚gelb‘ ein einfacher Begriff ist; daß man, so wie man unmöglich jemandem, der es nicht schon kennt, erklären kann, was gelb ist, diesem auch nicht erklären kann, was gut ist. Definitionen von der Art, wie ich sie suchte, Definitionen, welche das wahre Wesen des durch ein Wort bezeichneten Gegenstandes oder Begriffs beschreiben und nicht bloß angeben, was das Wort gewöhnlich bedeutet, sind nur möglich, wenn der fragliche Gegenstand oder Begriff komplex ist. Man kann ein Pferd definieren, weil Pferd viele erschiedene Eigenheiten und Qualitäten hat, die man allesamt aufzählen kann. Wenn man sie aber alle aufgezählt hat, wenn man ein Pferd auf seine einfachsten Begriffe [terms] zurückgeführt hat; dann kann man diese Begriffe nicht weiter definieren. Sie sind einfach etwas, woran man denkt, das man wahrnimmt; und jemandem, der nicht an sie denken, und sie nicht wahrnehmen kann, läßt sich ihr Wesen niemals durch eine Definition mitteilen. Vielleicht wendet jemand ein, daß wir imstande sind, anderen Personen Gegenstände zu beschreiben, die sie nie gesehen oder sich vorgestellt haben. Wir können z. B. einem Menschen klarmachen, was eine Chimäre ist, obwohl er nie davon gehört oder eine gesehen hat. Wir können ihm sagen, daß es ein Tier mit Kopf und Körper einer Löwin ist, dem ein Ziegenkopf aus der Rückenmitte herauswächst, und mit einer Schlange an Stelle eines Schwanzes. Aber hierbei ist der beschriebene Gegenstand ein komplexer Gegenstand, völlig aus Teilen zusammengesetzt, die uns allen vertraut sind eine Schlange, eine Ziege, eine Löwin -, und wir kennen auch die Art und Weise, wie diese Teile zusammenzusetzen sind, denn wir wissen, was mit der Mitte des Rückens einer Löwin gemeint ist und wo normalerweise ihr Schwanz sitzt. Und so ist es mit allen vorher nicht bekannten Gegenständen, die wir definieren können: sie sind alle komplex, aus Teilen zusammengesetzt, die zunächst selbst einer ähnlichen sein mögen, die jedoch schließlich auf einfachste Teile reduzierbar sein müssen, welche sich nicht mehr definieren lassen. Aber gelb und gut sind, wie gesagt, nicht komplex. Es sind Begriffe jener einfachen Art, aus denen sich Definitionen zusammensetzen und bei denen die Möglichkeit weiteren Definierens endet. […] Wir können aber beim Definieren von Pferd etwas viel Wichtigeres meinen. Nämlich, daß ein bestimmtes Objekt, das wir alle kennen, in bestimmter Weise zusammengesetzt ist: es hat vier Beine, einen Kopf, ein Herz, eine Leber usw., welche alle in bestimmter Beziehung zueinander stehen. Ich bestreite aber, daß gut in diesem Sinne definiert werden kann. Ich behaupte, daß es nicht aus irgend welchen Teilen zusammengesetzt ist, die wir in unserer Vorstellung dafür einsetzen können. Wir könnten über ein Pferd ebenso klar und genau nachdenken, wenn wir alle seine Teile und ihren Zusammenhang statt an das Ganze dächten; wir könnten uns wohl ebensogut vorstellen, wodurch sich ein Pferd von enem Esel unterscheidet, genauso zutreffend, wie wir es gerade tun, nur nicht so leicht. Aber es gibt ganz nd gar nichts, das wir so für gut einsetzen könnten. Das ist gemeint, wenn ich sage, gut sei undefinierbar.“ ↩︎
- Das Beispiel kam mir im Gespräch mit meinem Gott und Herrn Jesus Christus in den Sinn. Der Dank gilt Dir, dass du mir die Dinge erklärst. ↩︎
- G.E. Moore, Principia Ethica, Reclam, Erweiterte Ausgabe, 1996, S. 40f., Anmerk. d. Autors. ↩︎
- Siehe FN. 1. ↩︎
- Siehe G.E. Moore, Principia Ethica, Reclam, Erweiterte Ausgabe, 1996, S. 46ff. ↩︎
- Siehe Bert Heinrichs; George Edward Moore zur Einführung; Junius Verlag GmbH; 2019; S. 105. ↩︎
- ebd., S. 105. ↩︎
- ebd. ↩︎
- Siehe FN 1. ↩︎
- David Hume: A Treatise of Human Nature (Buch III, Teil I, Kapitel I); https://juergenfritz.com/2019/09/21/sein-sollen-fehlschluss-naturalistischer-fehlschluss/; https://de.wikipedia.org/wiki/Humes_Gesetz; zuletzt aufgerufen am 01.08.2025. ↩︎
- Dietmar Hübner; Praktische Philosophie 2a: Metaethik – Sein-Sollen-Fehlschluss vs. naturalistischer Fehlschluss; https://youtu.be/zt1V-MC4PeY?si=_vcoIZeQkP32FaIx&t=681, zuletzt aufgerufen am 01.08.2025. ↩︎
- Vgl. dazu folgendes Zitat in Frauke Brosius-Gersdorf, in Bericht der Kommission zur Reproduktiven Selbstbestimmung, Kapitel 5, S.186, https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Kom-rSF/Abschlussbericht_Kom-rSF.pdf: „Art. 1 Abs. 1 GG ist nach der […] Objektformel nur verletzt, wenn der Einzelne zum Objekt staatlichen Handelns herabgewürdigt wird. Ob und unter welchen Voraussetzungen diese Objektformel auch zur Anwendung kommt, wenn Übergriffe auf Grundrechte nicht vom Staat, sondern von einem Grundrechtsträger (hier: der Schwangeren) ausgehen, ist nicht geklärt. In jedem Fall dürfte eine Objektivierung nur in Betracht kommen, wenn die Subjektqualität des Menschen prinzipiell infrage gestellt wird, etwa indem als „lebenswert“ oder „lebensunwert“ kategorisiert wird. […] Die ‚bloße‘ Tötung eines Menschen ohne besondere, herabwürdigende Begleitumstände, die ihm seine Subjektqualität absprechen, verletzt Art. 1 Abs. 1 GG nicht. Zum Teil wird vertreten, dass der Schwangerschaftsabbruch schon deshalb keine Verletzung der Menschenwürde des Embryos/Fetus bewirkt, weil seine Tötung nicht vom Staat, sondern von der Frau ausgeht. Das Ungeborene werde bereits aus diesem Grund nicht zum Objekt staatlichen Handelns herabgewürdigt. Ungeachtet dessen ist mit der Beendigung einer Schwangerschaft durch die Frau nicht notwendig ein Unwerturteil über den Embryo/Fetus verbunden. Die Schwangerschaft wird in der Regel nicht beendet, weil der Embryo/Fetus als lebensunwert erachtet wird, sondern weil für die Frau eine Mutterschaft zu dem Zeitpunkt nicht vorstellbar ist. (Denkbar erscheint bei Annahme von Würdeschutz für den Embryo/Fetus eine Verletzung seiner Menschenwürde in Ausnahmesituationen, etwa wenn Embryonen wegen einer Behinderung generell das Lebensrecht abgesprochen wird oder bei einer Selektion von Embryonen aus Gründen des Geschlechts.)“ ↩︎
- Siehe Reinhard Merkel, Forschungsobjekt Embryo, Deutscher Taschenbuch Verlag, 2002, S. 89, Fussnote 126. ↩︎
- Reinhard Merkel, Forschungsobjekt Embryo, Deutscher Taschenbuch Verlag, 2002, 131f. ↩︎
- Texte zur Menschenwürde, Reclam, 2019, Herdegen, Grundrecht mit Spielraum, S. 265, Hervorheb. d. Autors. ↩︎
- Texte zur Menschenwürde, Reclam, 2019, Böckenförde, Gegen jede Relativierung, S. 274. ↩︎
- Präambel Grundgesetz Deutschland; https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html, zuletzt aufgerufen am 01.08.2025. ↩︎
- Arikel 1 GG und Artikel 2 GG; https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html, zuletzt aufgerufen am 01.08.2025. ↩︎
- „Entgegen einem verbreiteten Vorurteil ist weder das weitere noch das enge Naturrecht auf die These verpflichtet, dass Werturteile […] aus Tatsachenurteilen logisch ableitbar sein müssen (Sein/Sollen-Fehlschluss) […] In seiner rechtsphilosophischen Bedeutung heißt ’naturrechtlich‘ so viel wie ’nicht rechtspositivistisch‘. Die Kernthese der Rechtspositivisten lautet, dass die Geltung einer juridischen Norm allein von Konventionen und anderen sozialen Tatsachen ihrer Setzung (daher ‚Positivismus, von lat. ponere=’setzen‘) abhängt und nicht von ihrem etwaigen inhaltlichen Vorzügen. […] Aus naturrechtlcher Sicht könne daher nicht jeder beliebige Inhalt geltendes zumindest nicht uneingeschränkt geltendes Recht sein. Oft wird diese naturrechtliche Kernthese in einem Merksatz zusammengefasst, der Augustinus und Thomas von Aquin zugeschrieben wird, dessen Deutung jedoch umstritten ist: Lex iniusta est lex (‚Ein ungerechtes Gesetz ist kein Gesetz‘).“ In: Grundbegriffe der Philosophie, Herausgegeben von Stefan Jordan und Christian Nimtz, 6. Auflage, Reclam, 2023, Naturrecht, Markus Stephanians, S. 209f. ↩︎
- Frauke Brosius-Gersdorf, in Bericht der Kommission zur Reproduktiven Selbstbestimmung, Kapitel 5, S.165-220, https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Kom-rSF/Abschlussbericht_Kom-rSF.pdf, Erwähnung SKIP Argumente: S. 179, 180, 181, 182, 188, 189,192. ↩︎
- Frauke Brosius-Gersdorf; Menschenwürdegarantie und Lebensrecht für das Ungeborene – Reformbedarf beim Schwangerschaftsabbruch; in Rechtskonflikte: Festschrift für Horst Dreier zum 70. Geburtstag; Hrsg.: Brosius-Gersdorf, Engländer, Funke, Kuch, Tschentscher und Wittreck; 2024; S. 755f. Im Kommissionsbericht hieß es bspw.: „Anders als der geborene Mensch sei das Ungeborene auch nicht würdebegabt. Daran änderten die sog. SKIP-Argumente nichts, weil sich aus der Zugehörigkeit des Ungeborenen zur Spezies Mensch (Speziesargument), aus der kontinuierlichen Entwicklung des Embryos/Fetus (Kontinuitätsargument), seiner Identität mit dem späteren geborenen Menschen (Identitätsargument) und seinem Potenzial, sich als Mensch zu entwickeln (Potenzialitätsargument), keine Rückschlüsse auf den Würdeanspruch des Embryos/Fetus ergäben.“ Siehe FN. 18, S. 179 ↩︎
- „Soll die Achtung seiner Würde für jeden Menschen als solchen gelten, muss sie ihm von Anfang an, dem ersten Beginn seines Lebens zuerkannt und darauf erstreckt werden, nicht erst nach einem Intervall, das er – gegen Verzweckung und Beliebigkeit nicht abgeschirmt – erst einmal glücklich überstanden haben muss. Dieser erste Beginn eignen Lebens des sich ausbildenden und entwickelnden Menschen liegt nun aber in der Befruchtung, nicht erst später. Durch sie bildet sich gegenüber Samenzelle und Eizelle, die auch Formen menschlichen Lebens sind, neues und eigenständiges Lebewesen.“ aus: Texte zur Menschenwürde, Reclam, 2019; Ernst-Wolfgang Böckenförde, bleibt die Menschenwürde unantastbar?, S. 274. Siehe: https://youngandfree-kaleb.de/bleibt-die-menschenwuerde-unantastbar/. ↩︎
- Vgl. Robert Spaemann, Über den Begriff der Menschenwürde, in Texte zur Menschenwürde, Reclam, 2019, S. 232. ↩︎
- ebd., S. 231f. ↩︎
- Ludwig Wittgenstein, Logisch-Philosophische Abhandlung Tractatus Logico-Philosophicus, Reclam, 2024, Satz 6.52, S. 101. ↩︎
- Tractatus logico philosophicus, Die logische philosophische Abhandlung, Hörbuch, Gesprochen von Volker Braumann, 08.05.2025, Kapitel 35, 8:20Min.ff. ↩︎
- Siehe „1.6 Soll das der naturalistische Fehlschluss Sein? Erstes Fazit“ ↩︎
- Tractatus logico philosophicus, Die logische philosophische Abhandlung, Hörbuch, Gesprochen von Volker Braumann, 08.05.2025, Kapitel 35, 8:20Min.ff., Link von uns eingefügt. ↩︎


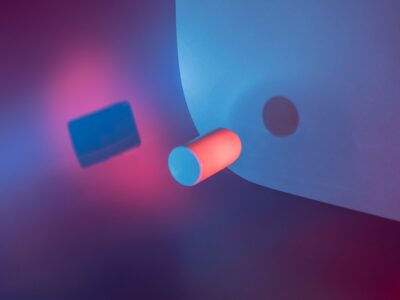

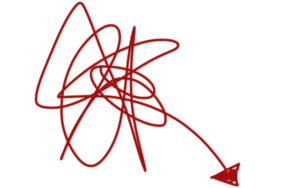





 Wer glaubt denn schon an den magischen Geburtskanal?
Wer glaubt denn schon an den magischen Geburtskanal?
Schreibe einen Kommentar